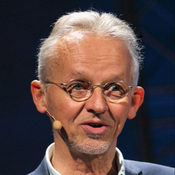- New
-
Topics
- All Categories
- Metaphysics and Epistemology
- Value Theory
- Science, Logic, and Mathematics
- Science, Logic, and Mathematics
- Logic and Philosophy of Logic
- Philosophy of Biology
- Philosophy of Cognitive Science
- Philosophy of Computing and Information
- Philosophy of Mathematics
- Philosophy of Physical Science
- Philosophy of Social Science
- Philosophy of Probability
- General Philosophy of Science
- Philosophy of Science, Misc
- History of Western Philosophy
- Philosophical Traditions
- Philosophy, Misc
- Other Academic Areas
- Journals
- Submit material
- More
Radikale Übersetzung und radikale Interpretation
In Nikola Kompa (ed.), Handbuch Sprachphilosophie. Stuttgart: Metzler. pp. 237-249 (2015)
Abstract
Die Theorien der radikalen Übersetzung und der radikalen Interpretation gehören zu den einflussreichsten sprachphilosophischen Theorien der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Mit dem Gedankenexperiment der Erstübersetzung einer völlig fremden Sprache hat Quine einen originellen Weg gefunden, Grundfragen der Bedeutungstheorie vom Ballast traditioneller Annahmen befreit neu zu stellen: Was ist überhaupt sprachliche Bedeutung, wie hängt sie mit außersprachlichen Reizen zusammen, auf die menschliche Tiere reagieren, welche Rolle sollte der Bedeutungsbegriff in der Sprachphilosophie spielen? Radikal an Quines Übersetzungstheorie sind nicht zuletzt seine Folgerungen. Sein Versuch, die Arbeit des Feldlinguisten im Dschungel möglichst voraussetzungsarm zu erklären, mündet in die These von der Übersetzungsunbestimmtheit und die Intensionsskepsis. Diese Doktrinen sind in der Sprachphilosophie hochumstritten geblieben. Sich mit Quine Rechenschaft darüber abzulegen, was ohne mentalistische Voraussetzungen erklärbar ist und was nicht, ist aber auch dann erkenntnisbefördernd, wenn man Quine in seiner empiristischen und behavioristischen Mittelbeschränkung nicht folgt. -/- Davidsons Theorie der radikalen Interpretation kommt das Verdienst zu, klassische hermeneutische Fragestellungen in eine allgemeine Bedeutungstheorie für natürliche Sprachen zu integrieren und mit Mitteln der analytischen Philosophie zu bearbeiten: Welches Wissen benötigt ein Interpret? Wie hängt sprachliche Bedeutung mit Absichten zusammen? Welchen Anteil am Verständigungserfolg hat der Sprecher, welchen der Interpret, welchen sprachliche Regeln? Überdies zeigt Davidson die engen Verbindungen zwischen der Sprachphilosophie und benachbarten philosophischen Disziplinen auf, insbesondere der Erkenntnistheorie, der Philosophie des Geistes und der Handlungstheorie. Er zeichnet im Spätwerk ein komplexes Bild davon, wie es Wesen wie uns gelingt, sich in ihrem verbalen und nichtverbalen Handeln miteinander zu verständigen, indem sie sich triangulierend auf eine gemeinsame, sprachlich erschlossene Welt beziehen.Author's Profile
Other Versions
No versions found
My notes
Similar books and articles
Holistische Stolpersteine in der Bedeutungslehre? Plädoyer gegen Quine und Davidson.Olaf L. Müller - 2002 - Facta Philosophica 4 (2):239-270.
Over de humor.F. J. J. Buytendijk & J. Linschoten - 1951 - Tijdschrift Voor Filosofie 13 (4):603-666.
Realismus und der Schluß auf die beste Erklärung in der Philosophie des Geistes.Rosemarie Rheinwald - 1998 - Zeitschrift für Philosophische Forschung 52 (4):497 - 521.
Danilo Pejović – ein Lehrer des Denkens.Mladen Živković - 2019 - Filozofska Istrazivanja 39 (2):393-414.
Gott ohne Theismus? Neue Positionen zu einer zeitlosen Frage.Rico Gutschmidt & Thomas Rentsch - 2016 - Münster, Deutschland: Mentis.
Semantik ohne Wahrheit.Robert B. Brandom & Matthias Haase - 2006 - Deutsche Zeitschrift für Philosophie 54 (3):449-466.
Versammelte Bewegung: zu Heideggers Interpretation des Logos und der Dynamis bei Platon und Aristoteles.Guang Yang - 2017 - Tübingen: Mohr Siebeck.
De leidende grondgedachten Van het moderne a-godsdienstige humanisme en hun onderlinge samenhang.J. Alleman - 1959 - Tijdschrift Voor Filosofie 21 (4):615-680.
Analytics
Added to PP
2015-07-25
Downloads
81 (#258,441)
6 months
14 (#227,991)
2015-07-25
Downloads
81 (#258,441)
6 months
14 (#227,991)
Historical graph of downloads